Parts of this text have been translated to Polish.

Jakub Gierszał als Dominik (Foto+Bildrechte: Jaroslaw Sosinski)
Adoleszenz wird als Filmstoff immer gern genommen, dabei darf es auch mal richtig qualvoll zugehen. Und auch virtuelle Welten sind ein Dauerthema, seien es die real existierenden Social Networks samt Entstehungsmythos, große Blockbusterfantasien wie Avatar oder, gerade neu aufgelegt, Tron. Die faszinierende Kombination aus beidem – Jugend plus Internet gleich 1000 neue Neurosen – liegt auf der Hand. Dabei sind durchaus einfühlsame Geschichten herausgekommen, etwa 2007 der belgische Film Ben X.
Im Panorama der 61. Berlinale hatte nun die polnische Produktion „Suicide Room“ Weltpremiere. Es geht um Dominik und schon der Filmtitel verrät, dass er nicht gerade kleine Probleme hat. Der Privatschüler steht 100 Tage vor der Abschlussprüfung und seine erfolgsgetriebenen Eltern lassen keinen Zweifel daran, dass sie von ihm nach der „Matura“ eine glänzende Karriere erwarten. Die Grundgeschichte ist einfach: Es gibt Probleme, Mobbing, apathische Eltern, Dominik findet Familienersatz im Internet und kokettiert in einer virtuellen Welt mit dem Selbstmord, gemeinsam mit einer fatalistischen Zweckgemeinschaft im „Suicide Room“. Deren Anführerin ist die geheimnisvolle Sylwia, die Dominik mit ihrer Kompromisslosigkeit fasziniert.
Diese Story hat großes Potenzial, in eine Art stereotypen Cyberspace-Exotismus abzugleiten. Doch das Team um Regisseur Jan Komasa hat einen geschickt ausbalancierten und reflektierten Film daraus gemacht.
Dominiks Eltern, eine gestresste Modemanagerin und ein finanzkrisengeplagter Ministeriumsmitarbeiter, werden zunächst als deutlich überforderte Snobs gezeichnet, die die Verantwortung für ihren Sohn an die Haushälterin, den Fahrer, die Eliteschule und später an Therapeuten „outsourcen“. Doch ihre Hilflosigkeit und Arroganz bleibt nicht plakativ, sie sind selbst in ihren Berufsrollen verfangen. Die Modewelt, als Symbol für äußerliche Inszenierung und die Finanzkrise, deren alternativloses Vokabular (Sachzwänge!) uns seit einigen Jahren begleiten, sind klug gewählt, um die Eltern zu Vertretern einer gegenwärtigen Gesellschaft zu machen.
Auch das Kernthema Suizid ist komplex angelegt. Die psychologische Binsenweisheit des Selbstmordversuches als bewusster „Hilferuf“ reflektiert Dominik von Anfang an und bringt die ultimative Drohung seiner ratlosen Mutter gegenüber gezielt in Stellung: „Du musst leiden wie nie zuvor.“ Aus der fatalen Philosophie seiner neuen Freundin Sylwia heraus („Alles was du brauchst ist in dir selbst.“) erfindet Dominik sich als Emo-Kid neu. Im Film ist das ein großer Auftritt in Zeitlupe und mit lauter Musik, doch am Ende zerfällt die Rolle, die er in der Schule spielt, und es bleibt eine hektische Flucht ins Taxi. Die Verneinung der sozialen Umgebung als vermeintlicher Ausweg wird schon hier als konstruierte Standardlösung entlarvt. Bei Komasa ist keine Geste so einfach gemeint, wie sie zunächst angelegt ist.
Die Räume des Films sind eng. Hin und wieder trifft sich die Familie im Auto, das Haus ist abgeschottet. Als Dominik im Büro seiner Mutter etwas abholen will, scheitert er an den Sicherheitseinrichtungen und kommt nicht einmal in den Aufzug. Und sein größtes Aufbegehren besteht schließlich darin, sein Zimmer nicht mehr zu verlassen, nach Vorbild von Sylwia, die nach eigener Aussage seit drei Jahren nicht mehr vor die Tür gegangen ist. Nur der virtuelle, titelgebende Suicide Room ist eine facettenreiche Fantasy-Welt, in der sich die Hoffnungslosen tummeln, versteckt hinter individualisierten Avataren.
Formal ist der Film selbst eine ganz eigene Konstruktion aus kühlen Kamerabildern, bunten Game-Welten, pixeliger Webcam und Chatprotokollen. Oper, Ballett, YouTube, Second Life – Suicide Room sucht seine meist engen Nahaufnahmen überall dort, wo Identitäten und Fassaden aufgebaut werden. Nur am unerwarteten Schluss steht schließlich eine befreiende Totale. Als Zuschauer im Kinosaal sind wir dabei immer schon auf den zweiten Rang verwiesen, weil wir jemandem über die Schulter blicken, der „Suicide Room“ im Internet anschaut. Der Beginn dieser Geschichte ist ein Play-Button auf YouTube. Sorry, Berlinale.
Die Verteilung der Erzählung auf die verschiedenen Bildkategorien funktioniert reibungslos, die Mischung aus etablierter Hochkultur (die Ballerina Weronika winkt Dominik als präsente Tür in eine bürgerliche Normalität) und rotzigem Internethumor hinterfragt alle ausgestellten Bühnen und ihre Konventionen gleichermaßen. Die Schauspieler Jakub Gierszał (Dominik) und insbesondere Roma Gasiorowska (Sylwia), die über weite Strecken des Films nur mit halb maskiertem Gesicht vor der Webcam agiert, greifen tief in die Tränenkiste, bleiben dabei aber direkt und überzeugend.
„Suicide Room“ trifft sein Thema angenehm differenziert. Die laute und bunte Bild- und Tonschlacht erschlägt dabei leider oft die leisen Töne der Geschichte, sodass diese erst im Rückblick zu erkennen sind.
„Suicide Room“ läuft im Panorama der 61. Berlinale noch am 16., 17. und 18.02. 2011 Details
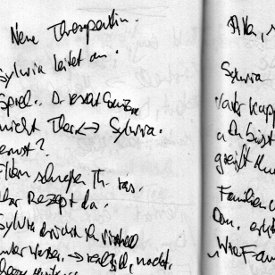




Große Teile dieses Textes sind ins Polnische übersetzt hier zu finden: http://www.pisf.pl/pl/kinematografia/news/o-polskich-filmach-w-berlinie Vielen Dank, interessant, auch wenn ich es nicht verstehe.