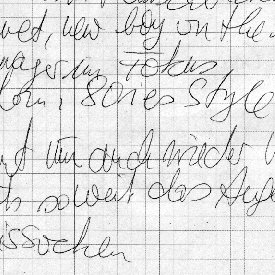Foto: Rumpus Films (alle Rechte vorbehalten)
„Cherry“ heißt eigentlich Angelina und ist ein braves Hollywood-Mädchen. Sie erträgt stoisch die zerrütteten Verhältnisse zu Hause und macht nur eine kleine Szene als ihr Freund (Nr. 1) sie für eine saftige Provision an einen Kumpel vermittelt, der Nacktfotos von ihr macht. Bei der ersten sich bietenden Gelegenheit türmt sie nach San Francisco, um endlich ein selbst bestimmtes Leben zu führen. Sie knüpft Kontakte zur Porno-Szene und verdient fortan ihre Brötchen als „Cherry“ in pornografischen Filmen für eine Internetplattform. Und da hört das Hollywood-Dasein auf. Allen kulturellen Codes entsprechend müsste die schöne Blonde nun mindestens mit Koks vollgepumpt, verprügelt und vergewaltigt werden, bis sie begreift, in welchen Moloch sie geraten ist und sich eines Besseren besinnt. Der lupenreine Retter würde vor den Toren der pornografischen Alptraumfabrik bereits auf sie warten – aber das passiert nicht.
Und genau das können einige Kritikerinnen dem Film „Cherry“ von Stephen Elliott, der bei der 62. Berlinale Weltpremiere feierte, nicht verzeihen. Es ist fast rührend, wie die wenigen vorhandenen Kritiken zum Film nach dem Bösen suchen, das der Film scheinbar „offensichtlich“ ausspart. So schreibt Jessica Kiang auf The Playlist:
In presenting the porn industry, without shading, as a refuge from addiction and exploitation and a career choice with great opportunities for upward mobility, at some point the film leaves the realm of believable narrative and enters that of propaganda (pornaganda?)
In der Tat, die dunkle Seite der Pornoindustrie ist in „Cherry“ keine interne Angelegenheit. Sie besteht vielmehr im Verhältnis zwischen der Welt der moralisch Überlegenen zum kulturellen Nichtort der Pornografie und allen, die damit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Dass sogar Angelinas alkoholsüchtige Mutter und der koksende Boyfriend (Nr. 2) sich über sie und ihren Job erheben, zeigt die Distanz, die zwischen Sex-Arbeit und dem gesellschaftlich Anerkannten liegt. Stephen Elliott und seine Co-Autorin Lorelei Lee wissen, wovon sie sprechen, beide sind oder waren selbst als Sex-Arbeiter tätig. Sie erzählen von der Porno-Industrie nicht als ausbeuterischem Moloch, sondern als routiniertem Business, in dem Frauen längst nicht nur vor der Kamera und schon gar nicht nur als hilflose Opfer agieren.
Auf einem anderen großen Berliner Festival, der Transmediale, sprach erst kürzlich der Netzaktivist Jacob Appelbaum im Rahmen des reSource: sex-Programms über seine Arbeit bei der Pornoproduktionsfirma kink.com. (Deren Hauptsitz in San Francisco dient übrigens als Kulisse in „Cherry“.) Appelbaum sprach von ziemlich normalen, keineswegs schmuddeligen Arbeitsverhältnissen. Normal allerdings auch im Sinne eines kapitalistischen finanziellen Drucks. Derselbe lastet auf Angelina in „Cherry“. Sie braucht Geld und trifft eine Wahl. Dass der Film diese Wahl (und jeden einzelnen damit verbundenen Schritt) beschreibt, ist sein großer Verdienst. Dass Kritikerinnen ihm genau das vorwerfen, zeigt auch ihre eigene Engstirnigkeit. Es zeigt sich aber in erster Linie die unumstößliche Grenze, die das Normale von der Pornografie trennt und auf der unsere (Hollywood-sozialisierte) Kultur basiert.
Auf der Ebene der Bilder überwindet „Cherry“ diese Grenze selbst nicht. Die skandalisierten Pornobilder bleiben klar aussortiert, sie werden im Film nicht gezeigt, die Hardcore-Drehs bleiben schön angedeutet. Die Kino-Zuschauer bleiben mit dem, was sie sehen dürfen, deutlich von dem fiktiven Porno-Publikum unterschieden, dem die fiktiven expliziten Aufnahmen vorbehalten sind. Das ist dem Filmmarkt geschuldet, der eine der prominentesten Bühnen für die Trennung zwischen Kunst und Porno ist. Tatsächlich pornografische Bilder hätten es auf die (eigentlich ja als mutig geltende) Berlinale wohl eher nicht geschafft.
Solche Bilder waren während der Berlinale-Woche statt dessen anderswo zu sehen. Parallel zu den Filmfestspielen zeigte das Kino Moviemento, in dem jährlich das Berliner Pornfilmfestival stattfindet, den Film „Fucking Different XXX“. Die Vorläufer der Queer-Crossover-Reihe „Fucking Different New York“ und „Fucking Different São Paulo“ waren noch im Berlinale Programm gelaufen – die enthielten aber auch keine explizite Pornografie, auf die sich die XXX-Version nun eingelassen hat. Vielleicht liegt es aber auch nicht an den Bildern allein, sondern an der allgemeinen Einfallslosigkeit des Kompilationsfilms. Die Idee schwule Regisseure lesbische Szenen inszenieren zu lassen (und umgekehrt) mag ihre identitätspolitische Schlagkraft verloren haben, das strenge Konzept wirkt nur mehr schematisch. Da können auch Todd Verow und Bruce LaBruce mit den bei weitem interessantesten Beiträgen nicht mehr viel reißen.
Im Berliner Festivalfrühjahr hat die Beschäftigung mit Sexualität und ihrer Medialisierung ihren Platz gefunden. Die kulturkonstituierende Unterscheidung zwischen Pornografie und hehrer Kunst ist damit noch nicht überwunden. Die Auseinandersetzung könnte differenzierter sein, auch mutiger, aber im besten Fall ist das ja erst der Anfang. Der Anfang der Revision einer Trennung zwischen Hollywoodheiligen und Huren, zwischen guten Bildern für den roten Teppich und schmutzigem Hinterzimmer-Kino. Den Forderungen der Sex-Arbeiter-Vereinigungen (z.B. NSWP) käme so ein Aufbruch jedenfalls entgegen.